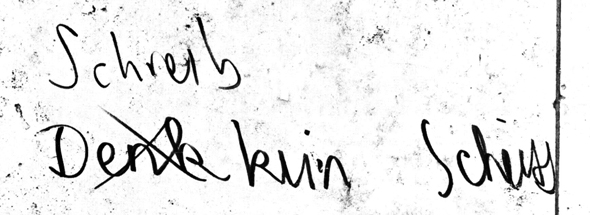
‹Bauen am Lehrkörper›: Ein Problem
Die Geschichte des Basler Lehrkörpers thematisieren wir unter der Metapher des Bauens. Der semantische Widerspruch ist gewollt.
‹Bau› und ‹Körper› vertragen sich schlecht. Die Wendung ‹Wachstum des Lehrkörpers› wäre semantisch stimmiger - historiographisch ist sie aber ungünstig gewählt. Zum einen ist in der Logik des Wachstums ein Rückwärtsprozess eigentlich nicht vorgesehen oder nur negativ konnotiert als Schrumpfung. Zum anderen suggeriert der Bedeutungshorizont des Organischen die Vorstellung einer naturwüchsigen Harmonie, in der sich einzelne Glieder und Teilfunktionen quasi automatisch ergänzen. Disfunktionen und innere Konflikte geraten aus dem Blick. Der ‹Körper› evoziert zudem ein Bild von historischer Entwicklung, das Linearitäten vor Brüchen privilegiert und sie auf einen ahistorischen Zielpunkt ausrichtet: den Zustand des Ausgewachsenseins.
Die technische Metapher des ‹Bauens› soll hier einen produktiven Gegenakzent setzen. Sie bringt all jene Vorstellungen ins Spiel, die mit Konstruktion, Statik und Renovation im handfesten Wortsinn verbunden sind. Den ‹Lehrkörper› als einen ‹gebauten› zu problematisieren, bedeutet, ihn als eine politisch gestaltete, kulturell verwobene sowie ökonomisch begrenzte Grösse zu verstehen. Eine Grösse, die den Lauf der Zeit nicht einfach aus sich selbst heraus ‹überlebt›, sondern zu deren Existenz permanente historische Anstrengungen – als Aus- oder Abbau, Um- oder Neubau – nötig sind. Eine Grösse, die sich nicht nur linear gleich bleibt bzw. verändert, sondern die sich gelegentlich auch abrupt wandeln kann. Beispiele hierzu sind etwa die Beschleunigung des Ausbaus in den 1960er Jahren und die personalstrukturelle Spaltung dieses Prozesses im Moment des konjunkturellen Einbruchs 1973.
Bauen in Kontexten, Bauen von unten, Bauen durch Zahlen
Die heuristische Grenze der Bau-Metapher ist dort erreicht, wo nur noch an ‹Baumeister› und ‹Reissbrett› gedacht wird. Das ‹Bauen am Lehrkörper› sollte man sich nicht zu dirigistisch vorstellen und auf einen Prozess reduzieren, der von Staatsbehörden oder Universitätsgremien ‹von oben› geplant und gesteuert wird. Globale und lokale Kontexte in Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, die weit über den Aktionsradius dieser Entscheidungsinstanzen hinausreichen, sind am ‹Bau› mindestens ebenso beteiligt wie die Verhältnisse und Ereignisse an den Rändern und in den unteren Etagen der akademischen Pyramide. Das Einfordern von Frauenstudium und geschlechtlicher Gleichstellung im Wissenschaftsbetrieb, die Mitbestimmungsfrage im Umkreis von ‹1968›, aber auch der klassische Prozess der disziplinären Ausdifferenzierung seit dem 19. Jahrhundert sind hierfür prominente Beispiele.
Auch die statistische Rekonstruktion der Personalentwicklung ist in einem bestimmten Sinn als ‹gebaut› zu verstehen. Die Erhebung numerischer Zeitreihen verlangt, dass die gewählten Rubriken im betrachteten Zeitraum als feste Grössen behandelt werden. Das ist in historischer Hinsicht nicht unproblematisch. Was erfasst wird, ist das Auf und Ab in der Ausprägung bestimmter Merkmale. Dagegen wird der Bedeutungswandel der Merkmale selbst in der Bildsprache der Diagramme von durchgezogenen Linien und einheitlichen Farben überschrieben. Der Stubengelehrte des frühen 19. Jahrhunderts, der an der exklusiven «Familienuniversität» der Stadtbürgerschaft Naturgeschichte aus neuhumanistischem Bildungsinteresse verfolgt, ist historisch eine sehr andere Figur als sein Kollege an der «Massenuniversität» des späten 20. Jahrhunderts, der im Labor-Team einer naturwissenschaftlichen Subdisziplin einen hochspezialisierten Beitrag zur industrienahen Grossforschung erarbeitet. Rein statistisch ist ein Unterschied zwischen beiden nicht auszumachen.
Der Begriff ‹Lehrkörper› ist in zwei Hinsichten unpräzis. Fast überall dort, wo vom «Lehrkörper» die Rede ist, sollte eigentlich vom «Lehr- und Forschungskörper» gesprochen werden. Diese Bezeichnungslücke begleitet den Begriff seit seiner Prägung um 1900. Und fast überall dort, wo im 19. und 20. Jahrhundert der Lehrkörper in den Blick kommt, sollte man sich einen männlichen Körper vor Augen halten. Frauen waren im akademischen Personal (zumindest unter den sichtbaren Amtsträgern) bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhundert eine seltene Ausnahme und sind zu Beginn des 21. Jahrhundert nach wie vor stark untervertreten, besonders auf den oberen Rangstufen.


